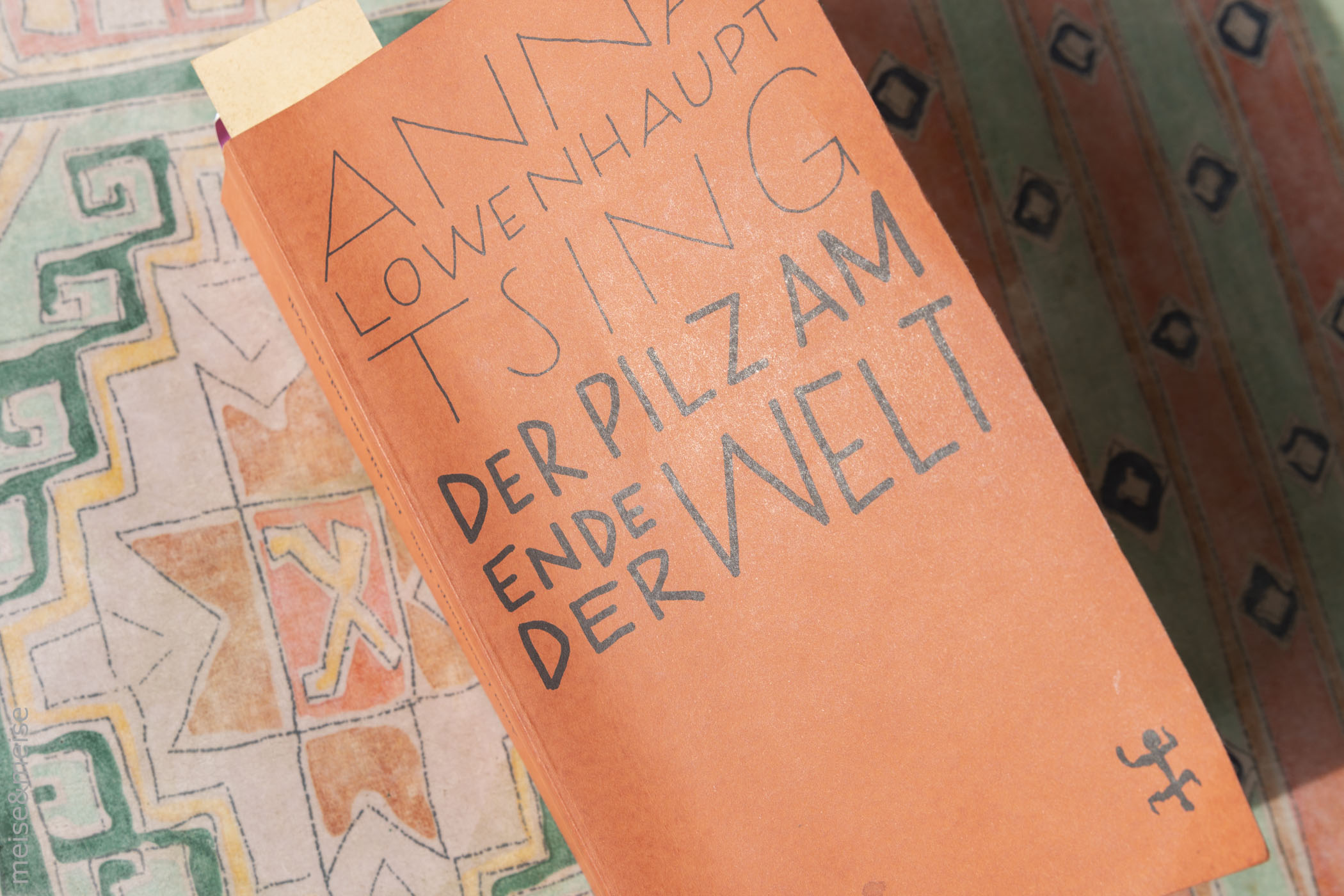Wo anfangen? Am liebsten würde ich dieses äußerlich so schlicht wirkende Buch über diesem Bildschirm schütteln, auf dass all die Ideen, Erzählstränge und von der Autorin geteilten Lernmomente vor mir in einem rauschend bunten Wortschwarm auf und in den Text flögen. Ein mäandrisches Buch, das Licht in die Strukturen und unseligen Mechanismen des Kapitalismus zu werfen vermag. Ebenso wie in die so grundverschiedene Weise, mit der Menschen auf der ganzen Welt versuchen, ihr Leben zu meistern. Oder die Natur zu schützen, mit Ansätzen die oft so schmerzhaft kurzsichtig waren oder sind, dass sie sich in ihr Gegenteil verkehren.
Roter Faden oder besser die Wegleuchte der Autorin ist der Matsutake-Pilz. Warenströme, Entfremdung á la Marx und Naturschutz anhand eines Pilzes auszuleuchten ist ungewöhnlich genug. Mehr noch überrascht mich, wie diese Wissenschaftlerin Wissen vermittelt: „Wenn ein Wirbel aufgewühlter Erzählungen am besten taugt, über kontaminierte Diversität zu erzählen, dann ist es an der Zeit, diesen Wirbel zu einem Teil unserer Wissenspraxis zu machen. Vielleicht müssen wir, die Überlebenden eines Krieges selbst so lange erzählen, bis alle unsere Geschichten von Tod, Todesgefahr und überflüssigem Leben uns zur Seite stehen, wenn es darum geht, den Herausforderungen der Gegenwart zu begegnen.“
Mit solchen Erzählungswirbeln löst sie die bewunderlichsten Denkanstöße aus. Führt sie die Leserschaft kreuz und quer durch die Welt. In Gegenden, die durch vermeintlichen Naturschutz oder ausbeuterische Übernutzung ökologisch ruiniert sind, weil man da so viel lernen kann. Wie etwa in den Kaskadenwäldern in Oregon. Vor 150 Jahren beherrschten dort riesige Ponderosakiefern das Bild. Sie wurden durch die weißen Siedler abgeholzt, und gleichzeitig machte es sich ein unerfahrener Forstwirtschaftler zur Aufgabe, Waldbrände zu verhindern. Gut gemeinter Gedanke, der allerdings dazu führte, dass die Ponderosakiefer komplett verschwand, weil ihre Samen ohne Feuer ihre Hüllen nicht sprengen und daher auch nicht keimen konnten. Die Landschaft, die daraus hervorging, beschreibt Lowenhaupt-Tsing als wenig attraktiv. Die einzigen, die mit dem niedergerockten Areal klarkamen waren Drehkiefern, die jetzt das Bild beherrschen und mittlerweile dort auch verarbeitet werden. Das ging nur, weil mit diesen Kiefern der Matsutake gedieh oder umgekehrt. Der Pilz nämlich vermag Gestein aufzubrechen und Mineralien herauszulösen und fungiert auch als unterirdisches Wassernetz – gut für den Baum. Im Gegenzug liefert der Baum Stoffwechselprodukte an den Pilz.
Pilz-Kollaborationen gibt es fast überall auf der Welt, dieser Matsutake allerdings ist ein besonders taffer Vertreter. Er soll der erste lebendige Organismus gewesen sein, der auf dem verseuchten Gebiet von Hiroshima wiederauftauchte, und sich auch in ruinierten Böden von Industriebrachen ungerührt ausbreitet. Das einzige, was er nicht mitmacht: Er lässt sich nicht züchten. Und das ist gut fürs kapitalistische Geschäft. Anna Lowenhaupt-Tsing setzte sich auf seine Spur, denn gesammelt wird er in großem Stil in den kargen Wäldern Oregons. Vor allem für Japaner, für die er der Pilz wiederum eine Art Socializing-Objekt ist. Bei sich zuhause haben sie ihn durch ihre Form der Waldwirtschaft verloren.
Die Autorin reist auf den Spuren und Sporen des Pilzes von den USA nach Norwegen bis Japan. Ganz nebenbei erläutert sie dabei ihre Thesen. Etwa jene, dass wir den Niedergang der Welt nicht mehr aufhalten können – uns also mit dem auseinandersetzen müssen, was sich uns bietet. Oder wie das Entwalden Japans dazu geführt hat, dass findige Geschäftsleute den Matsutake für sündhaft viel Geld aus den USA importieren. Wo er von Menschen gesammelt wird, zum Teil asiatischen Ursprungs, die während des Sammelns in Camps leben.
Die kreativ denkende Forscherin begleitet sie und sitzt nach getaner Arbeit mit ihnen am Feuer. Sie staunt, wie sie durch die Fertigkeit des Spurenlesens dem Wild folgen und Pilze finden können und schreibt: „Spurenlesen heißt die Verflechtungen der Welt erkennen.“ Sie schildert wie die Sammler sich freuen über besonders schöne Exemplare, wie viel Kennertum nötig ist, um die besten auszusortieren und zu guten Preisen zu verkaufen. Und wie fair die Mittelsmänner mit den Sammlern umgehen. Es ist nicht nur ein Job, es ist eine Lebensweise. Prekär, aber gleichzeitig frei. Auf einmal fühlte ich mich ihnen sehr nah. Nicht ohne Bewunderung konstatiert die Anthropologin: „Prekäres Leben ist stets ein Abenteuer.“
Ein Abenteuer ist in jedem Fall, ihr beim Denken zu folgen. Ihrer Lust, vorhandenes Wissen nach dem urbiologischen Prinzip der Kollaboration zu teilen. Sie teilt auch das Scheitern. Von Thesen, die sich als unhaltbar erweisen. Oder Abgehobenes, so wie jene Theorie, die davon ausgeht, dass Pilzsporen in der Lage sind durch die Atmosphäre zu gleiten und so überallhin zu gelangen. Wow! Als Leserin durfte ich ein bisschen mitsegeln und träumen.
Ein großartiges Buch, das auch allen ans Herz gelegt sei, die die bäuerliche Landwirtschaft voranbringen wollen. Lowenhaupt-Tsing bietet ihnen viele gute Argumente, warum diese Form der Landwirtschaft für Artenvielfalt, Landschaftsschutz, Bodengesundheit steht. Kurz: für nachhaltigen Klimaschutz. So viele Argumente, dass man sie plakatiert sehen möchte. Ach ja, und wie sich der Kapitalismus ad absurdum führt, steht auch drin. Wo anfangen? Sie will als ersten Schritt Neugier wecken – sie kanns.
Anna Lowenhaupt-Tsing: Der Pilz am Ende der Welt
445 Seiten, 15 Euro, Matthes&Seitz, Berlin 2019.